 Die unerträgliche Endlosigkeit des Gitarrenriffs: diejenigen, die The Fall von den enthaltenen „Hits“ wie „Victoria“ oder „Hit The North“ kennen, werden von dieser CD mit Sicherheit enttäuscht sein. Marc E. Smith lässt konsequent die alte Sperrigkeit wieder aufleben, die Alben wie „Perverted By Language“ auszeichnete, und nagelt die ohnehin schon wie herrische Tagesbefehle auf den Hörer einstürmenden Songs mit einem Sprechgesang zu, der selten bellender und bissiger war.
Die unerträgliche Endlosigkeit des Gitarrenriffs: diejenigen, die The Fall von den enthaltenen „Hits“ wie „Victoria“ oder „Hit The North“ kennen, werden von dieser CD mit Sicherheit enttäuscht sein. Marc E. Smith lässt konsequent die alte Sperrigkeit wieder aufleben, die Alben wie „Perverted By Language“ auszeichnete, und nagelt die ohnehin schon wie herrische Tagesbefehle auf den Hörer einstürmenden Songs mit einem Sprechgesang zu, der selten bellender und bissiger war.
Deutlich hörbar und angenehm auffallend ist die Abwesenheit von Produzent John Leckie, der den vorigen Fall-Alben das aufzwang, was er wohl unter dem „typischen Fall-Sound“ verstand; hier hingegen scheint überhaupt nur wenig produziert worden zu sein, vieles wirkt skizzenhaft, wie gerade mal im Wohnzimmer heruntergespielt. Vor allem Bass und Schlagzeug sind es, die mit ihrem wilden Stakkato-Tanz alles andere gegen die Wand drücken: rau und mächtig kommt diese Musik einher, statisch wie in Fels gehauen und gleichzeitig aufwühlend, wobei die Stakkati der Band wie stets als präzise Stichwortgeber für Smiths manische Monologe funktionieren. Die pure Energie. Das vielleicht beste Album der gegen alles und jeden idiosynkratischen Kultband aus Manchester.
The Fall: The Frenz Experiment
CD, 1988, Beggars Banquet / SPV
 Die Endlosigkeit des Riffs: Bei „Middle Class Revolt“ handelt es sich um das 18. Album von The Fall, und es ist innerhalb des Fall-Œuvres vielleicht das dichteste, kompakteste und überzeugendste Werk. Der zynische Outcast Marc E. Smith (man stelle sich eine Mittelklassenrevolte vor: Ha ha) fühlt sich inmitten seiner fallesken Gitarren hörbar zu Hause, die ihre rekursiven Monotonismen nur durch lustige Pfeif- und Schrillgeräusche auflockern lassen, welche an den bewusst naiven Synthesizer-Einsatz von Bands wie Pere Ubu erinnern.
Die Endlosigkeit des Riffs: Bei „Middle Class Revolt“ handelt es sich um das 18. Album von The Fall, und es ist innerhalb des Fall-Œuvres vielleicht das dichteste, kompakteste und überzeugendste Werk. Der zynische Outcast Marc E. Smith (man stelle sich eine Mittelklassenrevolte vor: Ha ha) fühlt sich inmitten seiner fallesken Gitarren hörbar zu Hause, die ihre rekursiven Monotonismen nur durch lustige Pfeif- und Schrillgeräusche auflockern lassen, welche an den bewusst naiven Synthesizer-Einsatz von Bands wie Pere Ubu erinnern.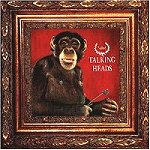 In Paris aufgenommen, präsentiert sich das letzte reguläre Studio-Album der
In Paris aufgenommen, präsentiert sich das letzte reguläre Studio-Album der  „15 digital cartoons from the de-evolution band“: Kann so etwas retrospektiv besehen noch zeitgemäß sein? Es kann: auf eine sehr merkwürdige, konsequent alle popmusikalischen Neuerungen der letzten 15 Jahre missverstehende und leugnende Art kann es das. In Kalifornien gehen die Uhren sowieso anders. „Total Devo“ ist genial pompöse, schrill überzogene Aufgeblasenheit: Wir stehen vor dieser Musik ähnlich peinlich fasziniert wie vor einer Frau, die sich zu stark geschminkt hat. Man höre sich nur die vollkommen bescheuerte Cover-Version von Presleys „Don’t Be Cruel“ an, oder das komplett überdreht hysterische „Agitated“.
„15 digital cartoons from the de-evolution band“: Kann so etwas retrospektiv besehen noch zeitgemäß sein? Es kann: auf eine sehr merkwürdige, konsequent alle popmusikalischen Neuerungen der letzten 15 Jahre missverstehende und leugnende Art kann es das. In Kalifornien gehen die Uhren sowieso anders. „Total Devo“ ist genial pompöse, schrill überzogene Aufgeblasenheit: Wir stehen vor dieser Musik ähnlich peinlich fasziniert wie vor einer Frau, die sich zu stark geschminkt hat. Man höre sich nur die vollkommen bescheuerte Cover-Version von Presleys „Don’t Be Cruel“ an, oder das komplett überdreht hysterische „Agitated“. „Es gibt nur gute Musik oder schlechte Musik“, hat Kurt Weill einmal zu einem Interviewer gesagt. Allerdings war damals das Sampling noch nicht erfunden, jenes technische Verfahren, welches es erlaubt, aus guter Musik schlechte zu machen und aus schlechter gute.
„Es gibt nur gute Musik oder schlechte Musik“, hat Kurt Weill einmal zu einem Interviewer gesagt. Allerdings war damals das Sampling noch nicht erfunden, jenes technische Verfahren, welches es erlaubt, aus guter Musik schlechte zu machen und aus schlechter gute.  In der Enzyklopädie der ganz wichtigen Punkbands gebührt
In der Enzyklopädie der ganz wichtigen Punkbands gebührt  Der Ex-Dead-Kennedys-Sänger auf den Spuren von Johnny Cash? Nun, ganz so schlimm ist es nicht, aber die Kooperation von
Der Ex-Dead-Kennedys-Sänger auf den Spuren von Johnny Cash? Nun, ganz so schlimm ist es nicht, aber die Kooperation von  Die Bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot stellt sich ausführlich vor. Und man muss sie einfach mögen, solch liebevoll aufgemachte CDs, die einen dazu verleiten, eine ganze CD-Kritik nur mit Booklet-Zitaten vollzuknallen; schon gerade, wenn besagte CD einen kompletten fiktiven Briefwechsel ominöser „Machthaber“, geheimnisvoller „Kollegen“ und der „Orchesterführung“ beinhaltet, und umso mehr, wenn allein die Titel für einen kompletten Reviewtext ausreichen würden (etwa „Das Lied vom Berge Kumgang-San“, frei nach Themen nordkoreanischer Revolutionsopern).
Die Bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot stellt sich ausführlich vor. Und man muss sie einfach mögen, solch liebevoll aufgemachte CDs, die einen dazu verleiten, eine ganze CD-Kritik nur mit Booklet-Zitaten vollzuknallen; schon gerade, wenn besagte CD einen kompletten fiktiven Briefwechsel ominöser „Machthaber“, geheimnisvoller „Kollegen“ und der „Orchesterführung“ beinhaltet, und umso mehr, wenn allein die Titel für einen kompletten Reviewtext ausreichen würden (etwa „Das Lied vom Berge Kumgang-San“, frei nach Themen nordkoreanischer Revolutionsopern). „Geography“ von Sonya Hunter lebt von einem Unterton der Traurigkeit, der, sacht und gleitend wie der länger werdende Schatten einer Sonnenuhr, wenn der Tag sich zum Abend neigt, die Stimmung der Songs prägt. Es scheint oft, als ob Frauen Traurigkeit glaubhafter künstlerisch umsetzen können, als Teil ihres Realitätssinns, vielleicht weil sie sich der Wirklichkeit von Geburt und Tod, Werden und Vergehen bewusster sind.
„Geography“ von Sonya Hunter lebt von einem Unterton der Traurigkeit, der, sacht und gleitend wie der länger werdende Schatten einer Sonnenuhr, wenn der Tag sich zum Abend neigt, die Stimmung der Songs prägt. Es scheint oft, als ob Frauen Traurigkeit glaubhafter künstlerisch umsetzen können, als Teil ihres Realitätssinns, vielleicht weil sie sich der Wirklichkeit von Geburt und Tod, Werden und Vergehen bewusster sind. Das vierte Album von Heidi Berry trägt keinen Namen, und was da so im Hintergrund geigt und gitarrt, sind natürlich so notorisch vergrübelte Typen wie Peter Astor von den Weather Prophets oder Jon Brookes von den Charlatans, die wahrscheinlich schon immer so eine Sängerin in ihrer Band haben wollten, die jenseits aller Pop-Diskurse einfach nur ihren folkloristisch-schlichten Pfad verfolgt, ein Schelm, wer Arges dabei denkt, und die zu allem Überdruss auch noch früher gemalt hat und behauptet: „I just did what I did very privatly.“
Das vierte Album von Heidi Berry trägt keinen Namen, und was da so im Hintergrund geigt und gitarrt, sind natürlich so notorisch vergrübelte Typen wie Peter Astor von den Weather Prophets oder Jon Brookes von den Charlatans, die wahrscheinlich schon immer so eine Sängerin in ihrer Band haben wollten, die jenseits aller Pop-Diskurse einfach nur ihren folkloristisch-schlichten Pfad verfolgt, ein Schelm, wer Arges dabei denkt, und die zu allem Überdruss auch noch früher gemalt hat und behauptet: „I just did what I did very privatly.“