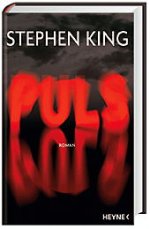 Richard Matheson verdankt seinem ersten Roman „I Am Legend“ von 1954 einen gewissen Kultstatus: Die düstere Geschichte, in der die Erde nach einem biologischen Krieg von aggressiven, vampirischen Mutanten heimgesucht wird, hat unter anderem 1968 George A. Romero zu seinem bahnbrechenden Zombiefilm „Night of the Living Dead“ (Die Nacht der lebenden Toten
Richard Matheson verdankt seinem ersten Roman „I Am Legend“ von 1954 einen gewissen Kultstatus: Die düstere Geschichte, in der die Erde nach einem biologischen Krieg von aggressiven, vampirischen Mutanten heimgesucht wird, hat unter anderem 1968 George A. Romero zu seinem bahnbrechenden Zombiefilm „Night of the Living Dead“ (Die Nacht der lebenden Toten![]() ) inspiriert. Liest man dann, dass Stephen King sein neues Buch „Puls“ (Originaltitel: „Cell“) diesen beiden Herren gewidmet hat, ist schnell klar, wo die Reise hingeht: Zombies erobern die Welt.
) inspiriert. Liest man dann, dass Stephen King sein neues Buch „Puls“ (Originaltitel: „Cell“) diesen beiden Herren gewidmet hat, ist schnell klar, wo die Reise hingeht: Zombies erobern die Welt.
Entsprechend schnell ist die Story erzählt: Der Comiczeichner Clayton Riddell läuft zufrieden durch Boston und will sich an einem sonnigen Nachmittag, von einem erfolgreichen Vertragsabschluss zurückgekehrt, gerade ein Eis kaufen, als um ihn herum das Inferno ausbricht: Sämtliche Menschen, die gerade mit ihren Handys telefoniert haben, verwandeln sich auf einen Schlag in geifernde Verrückte; mordlustige Bestien, die übereinander herfallen und merkwürdige Laute wie „Eeelah-a-babbalah! Kazzalah!“ von sich geben.
Clay kann sich retten und tut sich mit einer Handvoll Normalgebliebener zusammen: da ist etwa der sanftmütige Tom sowie die erst 15-jährige Alice, die sich dennoch bald zur Anführerin der kleinen Schicksalsgemeinschaft entwickelt. Die Flucht aus Boston mündet in eine lange Wanderung, an deren Ende Clay hofft, seine Frau Sharon und seinen Sohn Johnny wiederzusehen.
Stephen King hält sich nicht lange mit Vorreden auf: Bereits auf den ersten Seiten lässt er es ordentlich splattern. Ein junges Mädchen beißt einer Frau den Hals auf, ein Mann seinem Hund das Ohr ab, Autos stoßen zusammen, Flugzeuge stürzen ab, Menschen springen aus Fenstern, das volle Programm.

Das Inferno bricht aus: Illustration zu „Cell“ von Tomer Hanuka![]() .
.
Erst 50 Seiten später gönnt King dem Leser – wie auch seinen Protagonisten – eine kurze Verschnaufpause. Der Plot ist dabei zwar absolut unglaubwürdig, aber genial perfide: Was macht man, wenn man um sich herum alle durchdrehen sieht? Man greift zum Handy, um Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr oder sonst wen anzurufen – und gehört wenige Sekunden später auch zur splatterfreudigen Gemeinde der „Handy-Verrückten“, wie diejenigen süffisant genannt werden, die The Pulse zu hören bekommen haben. Im engeren Wortsinne sind die King’schen Handy-Maniacs natürlich keine Zombies, da sie noch leben, und in ihrer Agilität haben sie auch wenig gemeinsam mit Romeros tumb schlurfenden Untoten: Eher drängen sich filmische Assoziationen auf hin zu 28 Days later![]() von Danny Boyle, oder auch zu Klassikern wie Les Raisins de la Mort
von Danny Boyle, oder auch zu Klassikern wie Les Raisins de la Mort![]() von Jean Rollin oder Rabid
von Jean Rollin oder Rabid![]() von David Cronenberg.
von David Cronenberg.
Das Monströse bei Stephen King manifestierte sich schon häufiger darin, dass alltägliche Gegenstände um uns herum zu einem neuen, schrecklichen Leben erwachen. Das kann, wie in „Tommyknockers“, ein Cola-Automat sein, es können aber auch Autos („Christine“) oder Wäschetrockner („The Mangler“) sein. Das erzeugt tief greifendes Unbehagen – der amerikanische Soziologe Leon Festinger würde wohl von kognitiver Dissonanz sprechen – gerade dadurch, dass die Form seiner „Monster“ uns bereits hinreichend bekannt ist; es bedarf nur noch eines kleinen Anstoßes, um sie zu schrecklichem Leben zu erwecken.
Wer den tödlichen Impuls in den Äther gesetzt hat, lässt King bewusst offen: vielleicht Verrückte in einer Garage, vielleicht Terroristen, was spielt es für eine Rolle? Dadurch kommt er auch nicht groß in Verlegenheit, die ganze Sache technisch erklären zu müssen, und dem Leser bleiben einige hanebüchene Ausführungen erspart, die zur Geschichte sowieso nichts beigetragen hätten. Sicher darf man das Ganze ein wenig als parodistische Übertreibung des ganz realen Handy-Wahns sehen und als Rachephantasie des bekennenden Handyhassers King, der die Pointe zwar nicht direkt ausspricht, aber an mehreren Stellen des Buches mehr als deutlich werden lässt: Die Guten bleiben normal, die Doofen werden verrückt.
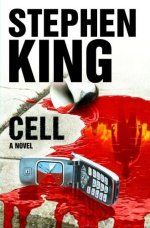 Die immerhin über 500 Seiten dicke Geschichte wird kontinuierlich und gradlinig erzählt, es gibt nur eine Zeit- und Raumachse, auf der sich die Helden durch das Buch bewegen, was aus dem anfangs eher als Splatterroman erscheinenden Epos schnell eine gemächlich vor sich hin treibende On-the-Road-Story werden lässt. Doch während die Protagonisten immer in Bewegung sind, erfährt der Leser leider nur wenig darüber, was sie bewegt – sorgfältige Ausziselierungen der Charaktere, sonst eine Spezialität von King, bleiben aus, was dazu führt, dass die Akteure insgesamt blass bleiben und die Distanz der Leser zu ihnen groß. Da wir Clays Familie nicht weiter kennenlernen, ist es uns eigentlich auch egal, ob er sie wiedersieht, das repetitive Sich-Berufen auf die Vater-Sohn-Liebe bleibt pures Klischee und reicht für ein wirkliches Mitfühlen und Mitfiebern nicht aus. Zumal das am Schluss unvermeidliche Wiedersehen sehr unglaubwürdig konstruiert wirkt, Clay durchquert eine Ortschaft, sieht seinen Jungen auf einem Bordstein hocken (ob verrückt oder nicht, sei an dieser Stelle nicht verraten) und denkt: „Das kann nicht sein.“ Und genau das denkt auch der Leser, ebenso gut hätte King den kleinen Johnny mit einem chinesischen Gong aus einer lila Rauchwolke hervorkommen lassen können.
Die immerhin über 500 Seiten dicke Geschichte wird kontinuierlich und gradlinig erzählt, es gibt nur eine Zeit- und Raumachse, auf der sich die Helden durch das Buch bewegen, was aus dem anfangs eher als Splatterroman erscheinenden Epos schnell eine gemächlich vor sich hin treibende On-the-Road-Story werden lässt. Doch während die Protagonisten immer in Bewegung sind, erfährt der Leser leider nur wenig darüber, was sie bewegt – sorgfältige Ausziselierungen der Charaktere, sonst eine Spezialität von King, bleiben aus, was dazu führt, dass die Akteure insgesamt blass bleiben und die Distanz der Leser zu ihnen groß. Da wir Clays Familie nicht weiter kennenlernen, ist es uns eigentlich auch egal, ob er sie wiedersieht, das repetitive Sich-Berufen auf die Vater-Sohn-Liebe bleibt pures Klischee und reicht für ein wirkliches Mitfühlen und Mitfiebern nicht aus. Zumal das am Schluss unvermeidliche Wiedersehen sehr unglaubwürdig konstruiert wirkt, Clay durchquert eine Ortschaft, sieht seinen Jungen auf einem Bordstein hocken (ob verrückt oder nicht, sei an dieser Stelle nicht verraten) und denkt: „Das kann nicht sein.“ Und genau das denkt auch der Leser, ebenso gut hätte King den kleinen Johnny mit einem chinesischen Gong aus einer lila Rauchwolke hervorkommen lassen können.
Auch, was die „Handy-Verrückten“ angeht, mutet uns King starken Tobak zu. Dass sie sich in sogenannten Schwärmen zusammentun und organisieren, na gut. Dass sie telepathische und sogar telekinetische Fähigkeiten entwickeln, na ja, auch gut. Dass sie aber am Schluss auch noch levitieren und frei über dem Boden schweben, wirkt nur aufgesetzt und albern, zumal diese Fähigkeit für die Handlung völlig ohne Bedeutung ist. Witzig hingegen wieder, dass die „Phoner“ einen äußerst schlechten Musikgeschmack entwickeln und sich vorzugsweise von seichten Bigband-Sounds berieseln lassen.
Das Resümee fällt zwiespältig aus. Auf der einen Seite freut man sich, nach dem überlangen und schlussendlich doch etwas zähen „Der dunkle Turm“-Zyklus einmal wieder einen „Old School“-King-Horror zu lesen, der ohne aufgebauschte Mythen auf den Punkt kommt und eine geradlinige und trashige Geschichte zum Besten gibt. Diese Geschichte hat aber andererseits – nach einem furiosen, fast übertrieben blutrünstigen Einstieg – doch viele Schwächen und Längen, die Helden übernachten mal hier und mal dort, treffen mal den, mal den, und oft will dabei der Funke nicht so richtig überspringen. Ferner fehlt ein wirklich böser Gegenspieler wie etwa Randall Flag in „The Stand“, es kristallisiert sich zwar quasi als Sprachrohr des Kollektivbewusstseins ein „Anführer“ der Handy-Verrückten heraus, dieser bleibt aber schablonenhaft, und auch die Verrückten selbst verlieren schnell ihre Bedrohlichkeit, da sie sich abends brav wie kleine Kinder schlafen legen und unsere Helden folglich nur nachts unterwegs sein müssen, um in relativer Sicherheit zu sein. King wäre besser beraten gewesen, wirklich fiese Nebencharaktere wie Gunnar und Harold als omnipräsente und lauernde Gefahr aufzubauen, anstatt sie in einem kurzen Kapitel schnell zu verheizen.
Nichtsdestoweniger vermag „Puls“ glänzend zu unterhalten, wenn man nicht zu hohe Erwartungen stellt und den Roman als das sieht, was er ist: solider Trash. King- und Horrorfans werden sich über die vielen liebevollen Anspielungen auf frühere Bücher oder auf Genre-Standards freuen, etwa, wenn die Riddells in ihrer Straße das letzte Haus auf der linken Seite![]() bewohnen oder Alice mutmaßt, dass die Handy-Verrückten auch Köpfe explodieren lassen können, weil sie das in einem alten Film
bewohnen oder Alice mutmaßt, dass die Handy-Verrückten auch Köpfe explodieren lassen können, weil sie das in einem alten Film![]() gesehen habe. Der „Meister der postliterarischen Prosa“ (Paul Gray) schafft es einmal mehr, intensive, farbige und bewegte Bilder im Kopf des Lesers entstehen zu lassen, Bilder, die nach einer Verfilmung geradezu schreien. Und, wie man hört, steht mit Eli Roth („Cabin Fever“, „Hostel“) ein in Sachen Splatter und Gore nicht gerade zimperlicher Regisseur bereits in den Startlöchern …
gesehen habe. Der „Meister der postliterarischen Prosa“ (Paul Gray) schafft es einmal mehr, intensive, farbige und bewegte Bilder im Kopf des Lesers entstehen zu lassen, Bilder, die nach einer Verfilmung geradezu schreien. Und, wie man hört, steht mit Eli Roth („Cabin Fever“, „Hostel“) ein in Sachen Splatter und Gore nicht gerade zimperlicher Regisseur bereits in den Startlöchern …
Nachtrag: Meine Kritik zum Stephen-King-Roman „Love“ findet sich hier.
Stephen King: Puls. HEYNE Verlag, 2006, 560 Seiten (gebunden). Das Buch ist auch als Hörbuch auf 12 CDs oder auf 2 MP3-CDs erschienen.