 Er hat es wirklich getan. Lou Reed spielte in der Philipshalle, in die trotz ausführlicher Vorberichterstattung nur knapp 1.000 Zuschauer fanden, sein Album „Berlin“ Stück für Stück in der Originalreihenfolge nach – ein Konzept, dass bereits The Cure mit ihrer Trilogy-Tour erfolgreich erprobt hatten. Und: Es war schlichtweg erstaunlich, wie die alten Songs in neuen Arrangements förmlich neu aufblühten.
Er hat es wirklich getan. Lou Reed spielte in der Philipshalle, in die trotz ausführlicher Vorberichterstattung nur knapp 1.000 Zuschauer fanden, sein Album „Berlin“ Stück für Stück in der Originalreihenfolge nach – ein Konzept, dass bereits The Cure mit ihrer Trilogy-Tour erfolgreich erprobt hatten. Und: Es war schlichtweg erstaunlich, wie die alten Songs in neuen Arrangements förmlich neu aufblühten.
Schon das Entree zeugte von Stilsicherheit: Über den Hintergrund der noch leeren Bühne fluteten Aufnahmen von Wellen und strömendem Wasser, kongenial dazu ausgewählt das 18-minütige „Like a Possum“ von der „Ecstasy“-CD, das brachiale Rückkopplungsberge auftürmte. Dann posiert sich die imposante Besetzung; links der 12-köpfige New London Children’s Choir, ein Kontrabassist und, auf einem Barhocker, die wundervolle Sängerin Sharon Jones, auf der rechten Seite die Streicher- und Bläserfraktion. Und mittig: die klassische Rock-’n‘-Roll-Besetzung, Steve Hunter an der Gitarre, der bereits das Originalalbum mit einspielte, Fernando Saunders als Bassist und Co-Sänger, Keyboard und Drums, und natürlich the Master himself, schlicht in Jeans und T-Shirt gekleidet und mit roter Gitarre.
Nach einer aufmerksamkeitsheischenden Ouvertüre – der Mädchenchor stimmt kurz den „Sad Song“-Refrain an – finden sich Fans des Albums sofort ein, der Anfang ist wie damals im Studio konzipiert: zielloses Klaviergeklimpere, im Hintergrund hört man „Happy Birthday to you“, und dann: „In Berlin … by the wall … you were five foot ten inches tall.“ Während der verhaltene Opener noch wenig Akzente setzt, wird spätestens beim stakkatohaften „Lady Day“ die Marschrichtung klar. Die gegensätzlichen Elemente von Klassik und Rock, die das „Berlin“-Album charakterisieren, scheinen im Original plötzlich nur noch angedeutet, so radikal werden sie hier betont, so fein ausziseliert sind die neuen Arrangements. Den klassischen Parts steht Rockdramatik im besten Sinne gegenüber, und das heißt unter anderem sich in unendliche Höhen fortschraubende Gitarrensoli sowie wahre Gitarrenduelle zwischen Reed und seinem alten Mitstreiter Steve Hunter. In diesen Momenten blüht der sonst reserviert wirkende Reed sichtlich auf, geht auf im instrumentalen Sog, den die ungewöhnliche, aber perfekt zusammengestellte Besetzung erzeugt.
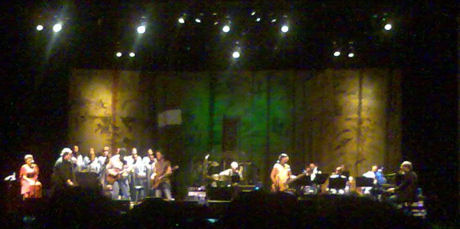
Aufgehen im instrumentalen Sog: Lou Reeds „Berlin“ in der Düsseldorfer Philipshalle.
Das oft Skizzenhafte, Unfertige der Berlin-Songs wird auf der Bühne vollends aufgehoben, was das Album im Nachhinein fast wie eine Vorstudie zum Konzert wirken lässt. Einen besonderen Reiz bildet der Kontrast zwischen den überdisziplinierten, reißbrettartigen Arrangements der Songs – hier sitzt jeder Trommelschlag, findet jeder Bläsertusch seinen exakten Platz – und den Freiheiten, die Reed der Truppe in den Refrains gewährt: Dort lässt er sie hemmungslos losgaloppieren, Freiräume werden eröffnet für lange Soli, schallernde Chöre, einen sich schichtweise steigernden und auftürmenden Wall of Sound, der das Publikum absolut in seinen Bann reißt – bis eine gebieterische Handbewegung von Lou Reed zum Schlagzeuger hin die letzten Takte ankündigt und die Band, aus dem Taumel des Refrainsturms erwachend, sich willig in das strenge Korsett des nächsten Songs fügt.
Höhepunkte sind sicher „Men of good fortune“, bei dem Sängerin Sharon Jones ihr souliges Stimmvolumen beweisen darf, oder aber „Oh Jim“, ein düsterer, böser Rock-’n‘-Roll-Song, von Lou Reed traditionell bewusst schlampig intoniert, aber auch hier wieder von den Bläsern und Streichern so akzentuiert aufgemöbelt, dass man den Eindruck hat, der Premiere dieses Songs beizuwohnen: So und nicht anders war das Stück gemeint. Die beiden Elegien „The Kids“ und „The Bed“ erzeugen eine düstere, schwere Atmosphäre – wobei ich das Kindergeheul in „The Kids“ schon auf dem Album für einen künstlerischen Missgriff, für eine allzu plakative Umsetzung hielt –, die erst durch das Abschlussstück „Sad Song“ wieder aufgebrochen wird. Hier kommt der Chor nochmals zur Geltung und darf hymnenhaft eine schier endlose Apotheose schmettern, die selbst das „Na, na, na, nananana“-Ende von „Hey Jude“ überhastet aussehen lässt. Brachial! Und ebenso heftig ist der Applaus, der anschließend losbricht und während der ausführlichen Vorstellung der Bandmitglieder nicht abebben will.
Was soll danach noch kommen? Zur Zugabe lässt sich Lou Reed lange bitten, doch schon mit den ersten Tönen des jaulenden Gitarrenintros ist jedem Fan klar, dass nach der Pflicht die Zeit der Kür gekommen ist: „Sweet Jane“, satt und druckvoll wie schon lange nicht mehr. „Satellite of Love“, das konsequent aufgebrochen wird: Die erste Strophe singt Fernando Saunders, die zweite Strophe übernimmt Reed und gibt für die dritte Strophe ab an den Mädchenchor – um dann fürs Fade-out seine rote Gitarre nochmals so richtig krachen zu lassen. Diesen schmutzigen, röhrenden Sound kriegt einfach nur Reed hin. Und schließlich, natürlich: „Holly came from miami f.l.a. … Hitch-hiked her way across the u.s.a.“ … der größte Hit von Lou Reed, „Walk on the Wild Side“, und wohl noch nie konnte man das berühmte „doo, do-doo, do-doo, do-do-do do do-doo“ des Refrains so glockenhell und rein von einer Bühne hören wie an diesem Abend vom New London Children’s Choir. Drei Zugaben, dreimal Lou Reed solo: Unmissverständlich ist die Botschaft, die Zeiten des expressiven Vortragens von Velvet-Underground-Klassikern wie „Heroin“ oder „I’m waiting for my Man“ sind vorbei, Lou Reed geht nur noch seinen eigenen Weg. Oder, wie an diesem Abend geschehen, er hält inne und schaut zurück. Genug zu sehen ist dort allemal. Danke für diesen Abend, Mister Reed!